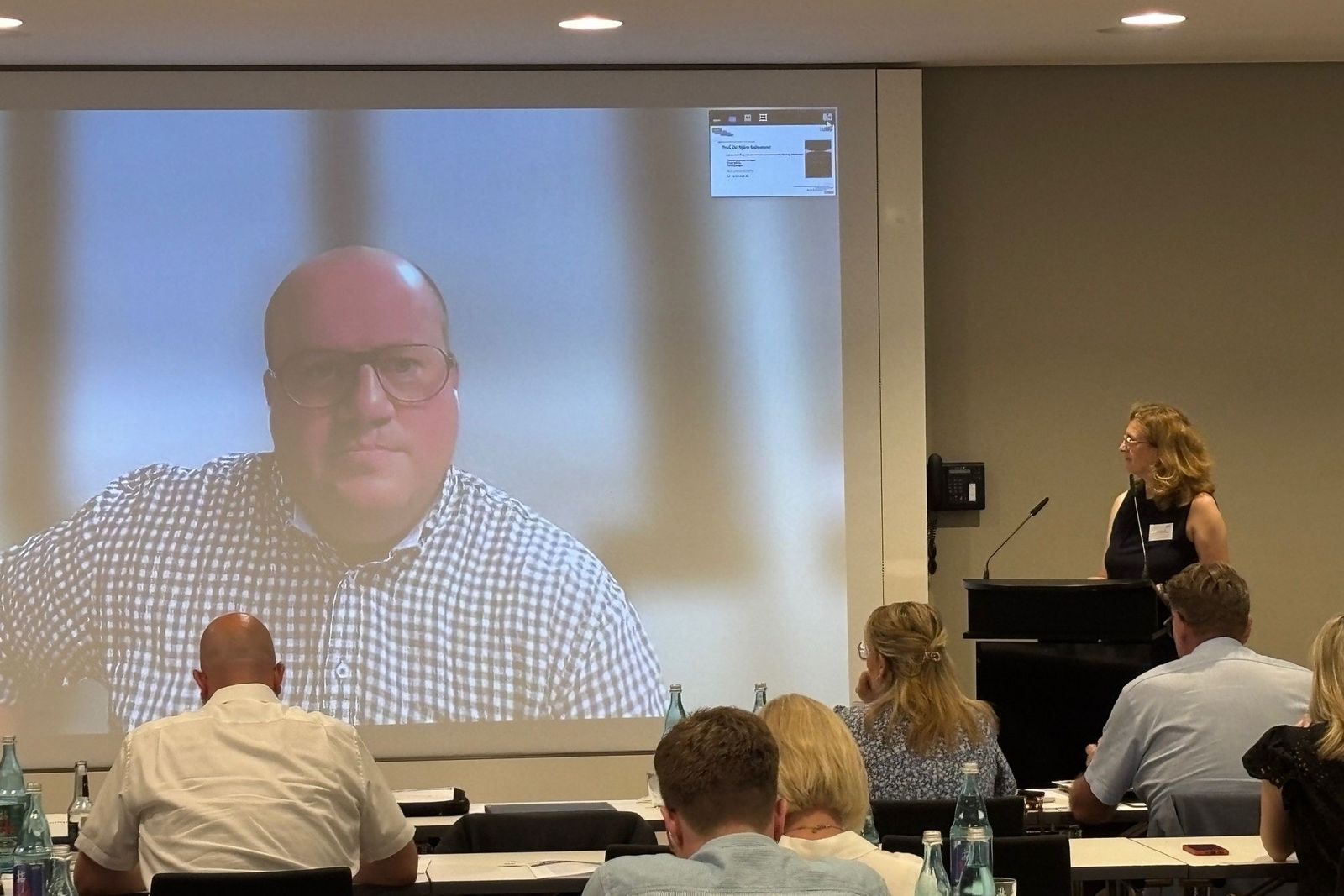Fachkräftemangel, demografischer Wandel, zunehmende Bürokratie – und gleichzeitig technische Innovationen, die enormes Potenzial bieten. Rund 150 Fach- und Führungskräfte aus Pflege, Wissenschaft, IT und Politik versammelten sich am 2. Juli 2025 beim sechsten Hybrid-Kolloquium des bpa in Dortmund, um über die Zukunft der Pflege im digitalen Zeitalter zu sprechen.
Die Veranstaltung mit dem Titel „Pflege der Zukunft: Mit Robotik, KI und Telematik auf neuen Wegen“ – wurde diesem Anspruch durch hochkarätige Vorträge, interaktive Formate und lebendige Diskussionen in jeder Hinsicht gerecht. Die Teilnahme war sowohl online als auch in Präsenz möglich.
„Pflege kann nicht auf Digitalisierung verzichten. Doch Digitalisierung muss die Pflege verstehen“, mit klaren Worten eröffnete Bernhard Rappenhöner, Vorsitzender der bpa-Landesgruppe NRW, das von seinem Landesverband organisierte Kolloquium. Rappenhöner betonte, dass der bpa die Digitalisierung aktiv mitgestalte – mit Pilotprojekten, politischem Druck und Know-how aus der Praxis.
Mit „TI im Dialog – 60 Minuten Klartext zur Telematik“ – folgte ein echtes Highlight: Das Diskussionspanel mit Sandra Stange (Referentin für Digitalisierung bpa Bund), Jens Biere (opta data) und Vincent Rappenhöner (Lebensbaum Lindlar) beleuchtete die Telematikinfrastruktur (TI) aus verschiedenen Perspektiven.
Sandra Stange erklärte den regulatorischen Rahmen und aktuelle Herausforderungen. Die Frist zur Verpflichtung zur Anbindung an die TI war am 1. Juli 2025 in Kraft getreten. Tagesaktuell konnte per Mentimeter abgestimmt werden: Wer von den Anwesenden (sowohl online als auch in Präsenz) ist tatsächlich schon an die TI angeschlossen? Interaktiv wurden die Ergebnisse angezeigt und diskutiert. Auch die bundesweiten Zahlen hatte Sandra Stange im Blick: 19.826 SMC-B Anträge lagen vor. Im Diskussionspanel zeigte Sandra Stange Unterstützungsangebote des bpa auf: Von Arbeitshilfen bis zu Videos steht alles für bpa-Mitglieder auf der Homepage bereit.
Jens Biere demonstrierte, wie TI in Softwarelösungen integriert wird und was sich beispielsweise hinter Begriffen wie SMC-B oder eHBA verbirgt.
Vincent Rappenhöner berichtete aus dem Alltag des Pilotprojekts: „Es braucht Geduld, aber es lohnt sich – TI macht uns schneller, sicherer, besser.“ Das Unternehmen Lebensbaum war eines der ersten, welches in der Pilotphase an die TI angebunden wurde. Rappenhöner schilderte, wie wichtig die Schulung der Mitarbeitenden sei, um sie mit auf die „TI-Reise“ zu nehmen und die Vorteile sowie Möglichkeiten für alle im Unternehmen transparent zu machen. Auch die Frage: „Wir sind angebunden – und dann?“ konnte Vincent Rappenhöner beantworten. Gerade in der Pilotphase gehe es darum, weitere Kommunikationspartner wie zum Beispiel Arztpraxen und andere an der Versorgung der Patienten Beteiligte für die frühzeitige Anbindung an die TI zu gewinnen – und als wertvoller Partner in der Telematikinfrastruktur wahrgenommen zu werden.
Cybercrime – Die unterschätzte Gefahr
Ein Gänsehautmoment: Inna Claus, Kriminaloberkommissarin des LKA NRW, machte unmissverständlich klar, wie real die Bedrohung durch Cyberangriffe ist – gerade im Gesundheitswesen. Ihr Vortrag reichte von Phishing-Mails über Systemerpressung bis zu Datenschutzlecks.
Viele Begrifflichkeiten wurden von ihr anschaulich mit Leben gefüllt und erklärt: Cyber-Erpressungen/Ransomware, (D)Dos-Angriffe, Supply-Chain-Angriffe, Phishing/Spear-Phishing, Betrug im Geschäftsverkehr/CEO-Fraud, Identitätsdiebstahl, KI-gestützten Phänomene und Wirtschaftsspionage.
Der Auszug aus dem Wirtschaftsschutzbericht 2023 verdeutlichte, dass es sich hierbei nicht um Einzelfälle handelt, sondern es bereits eine sehr hohe Fallzahl gibt und die Wirtschaft weiterhin eine deutliche Zunahme von Cyberattacken erwarten kann.
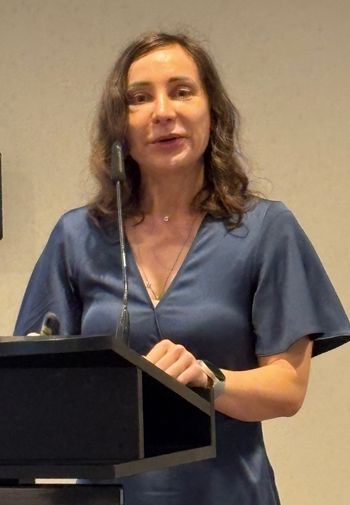
Inna Claus (Kriminaloberkommissarin des LKA NRW) zeigte auf, wie real die Bedrohung durch Cyberangriffe ist – gerade im Gesundheitswesen.
Besonders eindrucksvoll: reale Fallbeispiele, die erfolgreich oder nur knapp abgewehrt werden konnten. Wer sind die Täter und was motiviert sie? Inna Claus ging darauf ein, wie Unternehmen sich vor Cybercrime schützen können und welche Vorkehrungen man im privaten Bereich treffen kann.
Smartes Ersthelfersystem vorgestellt
Die Kombination aus Digitalisierung und Notfallhilfe demonstrierten Carolin Tietze und Anastasia Appelgants von der medgineering GmbH. Sie stellten das Smartphone-basierte Ersthelfersystem Mobile Retter vor, das in Sekunden Hilfe organisiert und unterstützt von KI Helferinnen und Helfer gezielt alarmiert und die Erstversorgung steuert.
Obwohl der Rettungsdienst durchschnittlich nach neun Minuten am Unfallort eintrifft, wird oft zu spät mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Hier setzt das Projekt Mobile Retter an. Medizinisch qualifizierte Ersthelferinnen und Ersthelfer, die sich in unmittelbarer Nähe des Notfalls befinden, werden von der örtlichen Leitstelle über eine Smartphone-App alarmiert – automatisiert und parallel zum Rettungsdienst. Allein durch die räumliche Nähe sind sie oft schneller am Notfallort und können bereits qualifizierte lebensrettende Maßnahmen einleiten. Mobile Retter stärken die Rettungskette, ohne die bisher etablierte Struktur des Rettungsdienstes grundlegend zu verändern.
Best Practice: Pflege digital
Thimmo Borger, Geschäftsführer der Pflege- & Gesundheitsteam GmbH (P&G) aus Haltern am See, brachte die Perspektive der ambulanten Pflege ein. Er präsentierte per Video praxiserprobte digitale Lösungen für Kommunikation, Erfassung von Arbeitsunfähigkeiten, Bestellanträge, Reparaturscheine und Medikamentenbestellung. Persönlich motiviert und in enger Abstimmung mit seinen Mitarbeitenden entwickelte und programmierte er selbst digitale Lösungen mit einem absoluten Mehrwert für seinen eigenen Pflegedienst.
Borger beschrieb auch, wo die Grenzen der digitalen Prozesse aus seiner Sicht liegen: Überforderung oder mangelnde Akzeptanz bei Mitarbeitenden, regulatorische Einschränkungen durch gesetzliche Vorgaben, Einhaltung normativer Vorgaben und fachlicher Standards, begrenzte finanzielle Ressourcen im eigenen Budgetrahmen und Gefahr von Over-Engineering.
KI-gestützte Biografiearbeit
Jeanette Bouffier präsentierte mit Teresa.AI ein sensibles, KI-gestütztes Tool zur digitalisierten Biografiearbeit. Ziel: Die Pflegeperson besser verstehen, um eine echte, individuelle Betreuung zu ermöglichen. Die KI rekonstruiert Lebensläufe, Interessen, Charaktereigenschaften – auf Grundlage von Gesprächen, Bildern, Texten. Sie bewahre Lebenserinnerungen und aktiviere, erhalte die Selbstorganisation, verbinde das Betreuungsnetzwerk und entlaste die pflegenden An- und Zugehörigen.
Revolutionäre Pflege: Wie KI die Zukunft gestaltet
Prof. Dr. Björn Sellemann (zugeschaltet via Livestream) eröffnete den „Zukunftsblock“. Als Pflegewissenschaftler, Medizin- und Pflegeinformatiker beleuchtete er, wie Künstliche Intelligenz nicht nur Analysen liefert, sondern Entscheidungen verbessert. Sellemann doziert an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK). In der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit am Gesundheitscampus Göttingen ist sein Lehrgebiet Pflege mit dem Forschungsschwerpunkt Nursing Informatics. Seine Botschaft: Pflegende müssen Anforderungen an die KI definieren – nicht umgekehrt! Es sei wichtig, dass professionell Pflegende (idealerweise bereits in der Ausbildung) auch digitale und KI-Kompetenzen erwerben und diese anwenden können.
Pflege 2030 – Interaktiver Vortrag
Marc Margulan, Geschäftsführer von Dexter Health, nahm das Publikum mit in die Pflege der Zukunft: Roboterassistenz, KI-basierte Pflegeplanung, Sensorik in Betten und Räumen, automatisierte Abläufe bei gleichzeitigem Fokus auf Menschlichkeit. Als ehemaliger Arzt hat er erlebt, wie entscheidend Pflegekräfte für das Gesundheitssystem sind – und wie oft ihnen die Zeit für das Wesentliche fehlt: Fürsorge und Menschlichkeit. Deshalb entwickelt er mit seinem Team Lösungen, die Pflegekräften genau das geben: Mehr Zeit für echte Pflege. Weniger Zeit für Papierkram durch KI-gestützte Lösungen, die administrative Arbeit reduzieren und Pflegekräfte entlasten.
Was wir von Netflix lernen können
Marc Urban, bpa-Mitglied Seniorenpark carpe diem, lieferte mit seinem Vortrag einen unterhaltsamen, aber zugleich tiefgründigen Abschluss der Vortragsreihe: „Pflegekräfte brauchen keine IT-Schulung – sie brauchen Systeme, die so intuitiv sind wie Netflix.“ Er stellte Konzepte vor, die zeigten, wie Software benutzerfreundlich, selbsterklärend und motivierend gestaltet und implementiert werden kann. Manchmal mache zum Beispiel einfach das „wording“ den Unterschied in der sprachgestützten Dokumentation der Flüssigkeitsbilanzierung: Eine Tasse Kaffee ist einfach etwas anderes als ein Pott Kaffee. Seine Empfehlung: im Gespräch mit dem Pflegepersonal bleiben und die digitalen Prozesse begleiten.